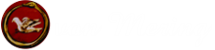So wie meine Vorfahrin Johanna Ramdohr eine richtige Pastorentochter war, so ist Christiana Charlotta Kammer eine richtige Müllerstochter. Die beiden sind Generationsgenossinnen: Johanna 1791, Charlotta 1787 geboren. Wenn ich eine dritte Vorfahrin, Anna Maria Ziemer, geboren 1773, noch dazunehme, so spanne ich einen Bogen von der Pfalz über Sachsen-Anhalt nach Schlesien. Alle drei Vorfahrinnen deutschsprachig - was jede wirklich redete, möchte ich mal hören! - alle drei evangelisch, - was sie wirklich glaubten, möchte ich wohl wissen! - das Schicksal aller drei erschüttert von Napoleons Heldentaten.
Charlottas Vater Johann Christian Kammer ist Windmüller, mindestens der dritte, vielleicht sogar der vierte in der Linie Kammer. Und auch die Großmutter Kammer, eine geborene Schurtzmann, stammte aus einer Windmüllerfamilie. Diese Windmüller lebten seit 1700 am Rande von Kobylin, einem Kolonialstädtchen in Großpolen. Es gab da viele Mühlen, denn wenn Wind war, musste das Korn gemahlen werden. Und es gab viel Korn in der eintönig grünen, fruchtbaren Ebene des Flusses Orla, der in die Bartsch mündet, einen Nebenfluss der Oder. Mindestens 100 Jahre hatten diese Windmüller als evangelische Deutsche in Polen gelebt, bewundert, beneidet, verleumdet, verfolgt. Eine Minderheit, die nicht im geringsten daran dachte, sich zu integrieren. Die Progrome erlebte, verarbeitete, überstand. Und aus Erfahrung wusste: Immer wieder gab es auch tolerante Zeiten.
Charlotta kannte es nicht anders. Wahrscheinlich war sie von klein auf zweisprachig. In der Familie, in der Kirche hörte sie nur Deutsch, mit den Nachbarn, den Mahlgästen, dem Gesinde sprach man Polnisch.
Als 1793 bei der sogenannten dritten Polnischen Teilung auch Kobylin an Preußen kam, da hat man davon vielleicht zunächst gar nicht viel gemerkt. Immerhin eröffnet Pfarrer Feye ein neues Kirchenbuch und schreibt aufs Deckblatt: "Tauf-Buch der Kirche zu Kobylin vom Tage der Huldigung Sr. Koenigl. Maj: v. Preußen Friedr. Wilhelm II den VII May 1793". Immerhin kommen preußische Beamte auch nach Kobylin. Sie zählen den Bestand des Städtchens - wegen der Steuern, wegen der Fördergelder, wegen der geplanten Verwaltungs- und Wirtschaftsreform. Sie zählen 2 Kirchen, 1 Rathaus, 1 Kloster mit 20 Mönchen, 22 Mühlen und 218 mit Stroh und Schindeln gedeckte Wohnhäuser. Sie zählen: 1542 Menschen, die Hälfte Polen, 230 Juden. Sie zählen 44 Leineweber, 40 Schuster, 28 Schneider (wovon 16 Juden) 24 Müller (sechs oder sieben davon sind mit mir verwandt), 13 Kürschner (wovon 5 Juden), 12 Fleischer, 7 Bäcker, 6 Stärkemacher, 5 Mützenmacher, 4 Hufschmiede, nur 2 Brauer und 1 Weinhändler. Sie zählen 3 Eisenhändler, 4 Leinwandhändler (3 davon Juden), 9 Lederhändler (letztere sämtlich Juden), 2 andere Kaufleute. Diese Zählung hat zwischen 1793 und 1798 stattgefunden.
Charlottas Mutter heißt Helena Boltze. Sie muß eine gesunde Frau gewesen sein. 9 Kinder bringt sie zur Welt, die meisten wie sie gesund und langlebig. Die Großmutter mütterlicherseits war eine geborene Rother. Das ist eine noch ältere Kobyliner Sippe als die Kammers, nur daß hier die meisten Männer Schuhmacher waren. Helenas Vater hingegen ist von auswärts, von Polnisch Hammer, gekommen. Er war Bäcker in Kobylin.
Charlotta ist das 8. Kind ihrer Eltern, das fünfte lebende. Das Sausen der Windmühlenflügel ist ihr vertraut, der Mehlstaub, das Treiben der Mahlgäste, die Korn anfahren, Mehl abholen, das Warten auf den Wind, das Warten, während der Mahlstein gewechselt wird. Einmal, da ist sie acht Jahre alt, steht die Mühle still. Da ist ihr Vater, 45jährig, gestorben.
Müller wurden nicht alt, auch meine Vorfahren auf den Windmühlen in Kobylin nicht. Man wusste noch nicht, wie schädlich Mehlstaub sein kann. Auch Unfälle waren häufig. Das Kirchenbuch berichtet lakonisch von Tod und Begräbnis. Die Todesursache zu wissen, maßte sich der Pfarrer im 18. Jahrhundert nicht an.
17 Monate lang bleibt Charlottas Mutter Witwe. Ungewöhnlich lange für damalige Zeit. Sie kann es sich leisten. Ihr ältester Sohn, Daniel Gottlieb Kammer, ist bei des Vaters Tod schon 21 Jahre alt. Wahrscheinlich übernimmt er sofort die Mühle, denn bei seiner Heirat ein Jahr später ist er bereits Mühlenmeister. Und nachdem eine junge Müllersfrau auf der Mühle ist, kann auch die Mutter zur zweiten Ehe schreiten. Sie heiratet einen angesehenen Mann, den Bürger und Kirchvater Tschuschke, aus einer ebenfalls alten, dazu wohlhabenden Kobyliner Familie. Er ist lange mit der Familie bekannt, der Pate der jüngsten Tochter Susanna. Aber er ist kein Mühlenmeister, sondern Schuhmacher. Charlotta, jetzt 9 Jahre alt, tritt aus dem Schatten der Windmühlenflügel. Sie übersiedelt vom Dorfrand an den Markt, in den Umkreis des Rathauses, in die Nähe der steinernen katholischen und der hölzernen evangelischen Kirche, wohl auch näher zur Schule.
War ihr das nicht recht? Oder freute sie sich darüber? Hat ihr ihr Vater gefehlt? Das Rauschen der Windmühlenflügel, die Freiheit da draußen und das Gewimmel der Mahlgäste mit ihren Gespannen den ganzen Herbst und noch einen großen Teil des Winters? Oder war im Gegenteil der Dorfplatz lustiger? Das Haus bequemer? Die Schule unterhaltend? Hatte die Mutter mehr Zeit?
Der Stiefvater ist nur 4 Jahre älter als der leibliche. Auch er ist Witwer und hat erwachsene Kinder. Gemeinsame Kinder hat das Paar nicht mehr. Charlotta und ihre Schwester Susanna bleiben die Jüngsten im Hause.
Die älteren Schwestern heiraten, Helena mit 18, sie zieht nach Punitz, Renata mit 19 Jahren, sie heiratet wieder einen Kobyliner Müller. Charlotta will nicht nachstehen. Mit noch nicht ganz 18 gebiert sie ihr erstes Kind. Es wird 1805 in Kobylin getauft.
Charlottas Heirat habe ich nicht finden können. In der hölzernen Kirche von Kobylin, dem "Schiffchen Christi", jedenfalls hat sie Christian Carl Liebert, den Mühlenmeister, nicht geheiratet, auch nicht in Zduny oder Jutroschin, Rawitz oder Krotoschin, den Nachbarorten. Aber Charlottas erster Sohn ist nicht etwa unehelich, das wäre vermerkt worden. Sie wird „Ehefrau“ genannt. Sie muss woanders getraut sein.Vielleicht arbeitete Carl Christian zu dieser Zeit noch auf einer fremden Mühle. Seine Eltern lebten 1804 nämlich noch beide, vielleicht war für das junge Paar kein Platz auf der Stadtmühle. Oder war er etwa polnischer Soldat? 1804, da ist er 25 Jahre alt.
Alle Kinder Charlottas aber werden im "Schifflein Christi" getauft. Der Turm dieser Kirche steht noch, eine anmutige Holzkonstruktion. Aus Stein durften Evangelische nicht bauen. Darauf bestand der katholische Bischof. Charlotta kannte es nicht anders. Sie lebte nun wieder im Schatten der Windmühlenflügel wie zu ihrer Kinderzeit. Das Rauschen der Flügel, das Knacken des Mahlwerks, der Mehlstaub, der Lärm der Mahlgäste im Herbst. Dass ihr zweites Kind, die Tochter Florentina, nicht mehr in Preußen, sondern wieder in Polen geboren wird, fiel dagegen vielleicht gar nicht ins Gewicht. Napoleon hatte 1806 Preußen besiegt, auch mit Hilfe polnischer Kontingente, und hatte im Frieden von Tilsit den Polen ihr Gebiet als Herzogtum Warschau wiederverschafft. Das war für diese Müllerfamilien vielleicht weniger erschütternd als das Warten auf Wind. Dass Florentina und auch Daniel Benjamin, das dritte Kind und mein Vorfahr, als Bürgerkinder in der evangelischen Kirche getauft wurden, war wichtiger als Preußen oder Napoleon. Und dass Florentina so früh starb, schlimmer als Truppendurchzüge.
Aus Stein durften Evangelische nicht bauen. Darauf bestand der katholische Bischof. Charlotta kannte es nicht anders. Sie lebte nun wieder im Schatten der Windmühlenflügel wie zu ihrer Kinderzeit. Das Rauschen der Flügel, das Knacken des Mahlwerks, der Mehlstaub, der Lärm der Mahlgäste im Herbst. Dass ihr zweites Kind, die Tochter Florentina, nicht mehr in Preußen, sondern wieder in Polen geboren wird, fiel dagegen vielleicht gar nicht ins Gewicht. Napoleon hatte 1806 Preußen besiegt, auch mit Hilfe polnischer Kontingente, und hatte im Frieden von Tilsit den Polen ihr Gebiet als Herzogtum Warschau wiederverschafft. Das war für diese Müllerfamilien vielleicht weniger erschütternd als das Warten auf Wind. Dass Florentina und auch Daniel Benjamin, das dritte Kind und mein Vorfahr, als Bürgerkinder in der evangelischen Kirche getauft wurden, war wichtiger als Preußen oder Napoleon. Und dass Florentina so früh starb, schlimmer als Truppendurchzüge.
Darüber würde ich gerne viel mehr wissen. Die Geschichtsschreiber haben später in den Klagen der deutschen Minderheit über Ungleichbehandlung durch die Regierung oder Unterdrückung durch die herrschende katholische Kirche immer nationale Töne gehört. Muss man das hören, wenn einer sich als Mensch, als Handwerksmeister, als Angehöriger einer Minderheit benachteiligt fühlt? Charlotta kann ich nicht mehr fragen. Sie gebiert noch ein 4. Kind, dann stirbt sie, mit 23 Jahren. Sie hat nicht die gute Natur ihrer Mutter geerbt, sie stirbt in den immer risikoreichen 6 Wochen nach der Entbindung. Und obwohl ihr Mann sofort wieder heiratet, hat auch der Säugling nicht überlebt. Das Töchterlein Florentina ist schon vorher gestorben.
Charlotta ist in Polen begraben, auf dem evangelischen Friedhof von Kobylin beim "Schifflein Christi". Den Untergang des napoleonischen Heeres in Russland und die Völkerschlacht bei Leipzig hat sie nicht mehr erlebt. Und so hat sie auch nicht mehr miterlebt, dass Kobylin nach dem Wiener Kongress wieder an Preußen fiel. Von 1815 bis 1920, 105 Jahre lang wurde Kobylin von Berlin aus regiert. Heute besuche ich die Heimat meiner Vorfahren wieder in Polen.
Nur zwei von Charlottas Söhnen, Carl und Benjamin werden von Vater und Stiefmutter aufgezogen. Und obwohl auch die Stiefmutter Müllerstochter ist, werden sie nicht mehr Windmüller, sondern Bäcker. Charlotta Liebert, geborene Kammer, war die letzte von neun Windmüllerfrauen unter meinen Vorfahrinnen in Kobylin.